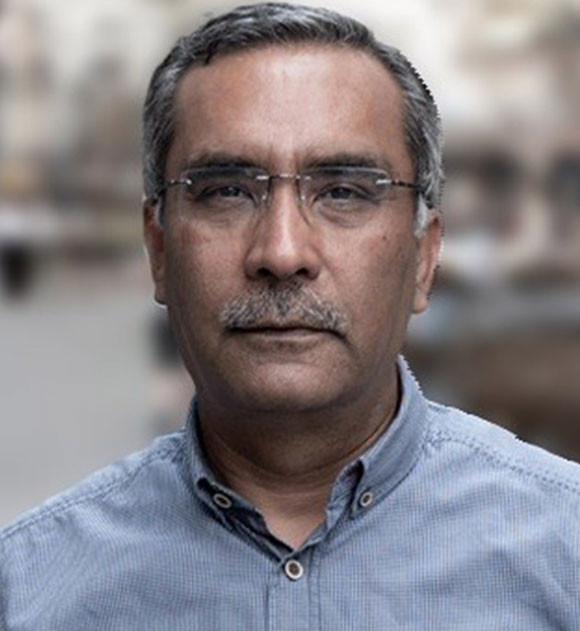Verbände
Bio 3.0: gewappnet für die Zukunft
Der Welt-Bio-Verband IFOAM – Organics International will neue Wege gehen

30 Prozent Ökolandbau bis 2030: Dieses ehrgeizige Ziel hat sich die deutsche Bundesregierung gesetzt. Während die Umsetzung aktuell in den Sternen steht, rangiert die Bio-Produktion global immer noch bei unter drei Prozent. Eine Strategie, um gegenzusteuern, hat der Welt-Bio-Dachverband IFOAM – Organics International unter dem Stichwort Bio 3.0 formuliert. Damit will sich die Branche modern und innovativ aufstellen, noch nachhaltiger werden und positive Effekte für Mensch und Planet steigern. Thomas Cierpka, Senior Manager Membership & Operations bei IFOAM, gibt Einblick in das Konzept und aktuelle Herausforderungen.
„Die Entscheidung für Bio 3.0 fiel bei unserer Hauptversammlung 2017 in Indien“, erzählt Cierpka. „Wir wollten den Bio-Sektor zukunftsfähig machen für weiteres Wachstum, unser Blickfeld öffnen, um mainstreamfähiger zu werden. Alle möglichen Wege der Vermarktung und Kooperation sollten ausgeschöpft werden. Und für Umstellungswillige sollte die Bio-Zertifizierung auch bezahlbar sein – besonders für Kleinbauern.“
Grundlage für das neue ganzheitliche Konzept und die Weiterentwicklung von Best Practices für die Bio-Branche sind auch weiterhin die vier Prinzipien des biologischen Landbaus: Gesundheit, Ökologie, Fairness und Sorgfalt. Sie wurden bereits 2005 auf der IFOAM-Hauptversammlung in Australien unter Beteiligung zahlreicher internationaler Stakeholder festgelegt und dienen seither als Maßstab für die globale Bio-Gemeinschaft.
Auf dem Weg von den Prinzipien in die Praxis hilft zum Beispiel IFOAMs ‚Best-Practice-Leitfaden für Landwirtschaft und Wertschöpfungsketten‘. Praktiken, die bereits weltweit angewandt werden und mehr als Basis-Bio bedeuten, sind dort zusammengefasst. Neben ökologischen geht es dabei auch um soziale, kulturelle und wirtschaftliche Komponenten – und um ‚accountability‘, darum, die Konsequenzen des Handelns bei der Umsetzung mitzudenken. „Es gibt heute praktische Erfahrungen, die weit über den EU-Bio-Standard hinausgehen“, so Cierpka.
Derweil hat sich auch die Wahrnehmung der Branche in der Öffentlichkeit und internationalen Politik geändert. „Vor 30 Jahren galten Bios bei der FAO (UN Food and Agriculture Organization) noch als Spinner“, erinnert sich der IFOAM-Manager. Heute werden im Hause der FAO in Rom Informationsveranstaltungen zu Bio-Landwirtschaft, Agrarökologie und Welternährung durchgeführt und es gibt verschiedene Initiativen, um den Ökolandbau als Lösungsansatz in Projekte zu integrieren. Es hat sich also einiges getan.
Mehr Offenheit und Kreativität
Mit Bio 3.0 sollen nun noch mehr Menschen für den ökologischen und nachhaltigen Landbau erreicht werden. „Es geht darum, ideologische Schranken abzubauen und auch denen zu helfen, die guten Willens sind und erste Schritte tun wollen“, erklärt Cierpka.
Ein wichtiges Ziel sind bessere Rahmenbedingungen im Sinne des True Cost Accountings, die dafür sorgen, dass gesellschaftliche Leistungen auch belohnt und externe Kosten internalisiert werden. Außerdem gibt IFOAM sowohl Regierungen als auch Unternehmen Instrumente an die Hand, um sich mehr in Richtung Bio zu entwickeln. Im ‚Policy Tool Kit‘ hat der Verband Erfahrungen aus 90 Ländern darüber zusammengetragen, wie der Ökolandbau gefördert und negative Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der konventionellen Landwirtschaft vermindert werden können.
Mit Blick auf die Aufnahmebereitschaft des Konzepts Bio 3.0 ist die Lage in verschiedenen Ländern der Welt laut Cierpka unterschiedlich. In Madagaskar habe es zum Beispiel viel Interesse gegeben. Auf der IFOAM-Website können Staaten anhand eines kurzen Fragebogens ihren Status Quo ermitteln und bekommen daraufhin automatisch Empfehlungen für Instrumente und nächste Schritte.
In Deutschland und der Europäischen Union ist die Bio-Regulierung schon sehr weit fortgeschritten. „Es gibt aber auch Formen der Verifizierung, die ohne Drittprüfer auskommen“, so Cierpka. Sie seien allerdings alle mit mehr Aufwand für die Konsumenten verbunden. So verpachte ein Bio-Bauer in Köln 100-Quadratmeter-Streifen an Anwohner, die dort selbst Gemüse anbauen können – quasi als Gartenalternative. Auch Modelle wie die solidarische Landwirtschaft, bei der regelmäßig Ernte-Anteile abgenommen werden, funktionieren über direkte Vertrauensbildung und Teilnahme. „Wir müssen Natur und Nahrungsmittelproduktion für die Menschen wieder erfahrbarer machen“, meint Cierpka.
Beim Thema, wie man ökologische Ansätze in das Bewusstsein aller bekommt, sei nach wie vor Kreativität gefragt. Momentan wehe der Branche viel Gegenwind entgegen und die andere Seite verfüge über viele Mittel.
Ernährungssicherung, Glyphosat und In-Vitro-Fleisch
„Die Frage, ob der Ökolandbau die Welt ernähren kann, stellt sich so eigentlich gar nicht“, findet Cierpka. Die konventionelle Agrarindustrie schaffe es schließlich bis heute nicht, Ernährungssicherheit für alle zu garantieren. Richtig formuliert gehe es darum, was nötig ist, um den Hunger weltweit zu minimieren – und bei der Antwort stünden neben der Produktion auch landwirtschaftliche Verteilungswege im Fokus.
„Kleinlandwirtschaftliche Produzenten zeigen weltweit, dass Biolandbau die Ernährungsvielfalt und -sicherheit erhöht“, betont Cierpka. Das fortschreitende Sterben von Handwerk und Bauern bedeute für die Ernährungswirtschaft einen Aderlass. Und auch Organisationen wie der Deutsche Bauernverband (DBV) verträten nicht die Interessen der Kleinen. IFOAM setzt sich daher gezielt für die Marktzugänge von Kleinproduzenten ein.
„Kaffeebauern in Bolivien oder Nicaragua bekommen das Gift, das sie spritzen, selbst ungeschützt ab“, prangert Cierpka an. „Dass Glyphosat noch nicht eindeutig vom Markt genommen wurde, ist eine Katastrophe.“ Nach zahlreichen wissenschaftlichen Studien, die die Schädlichkeit des Totalherbizids beweisen, stelle die Verlängerung auf EU-Ebene mit Blick auf das Vorsorgeprinzip ein Verbrechen dar. „Hier wird die Übermacht einer Agrarindustrie-Lobby sichtbar, die gegen jede Vernunft agiert“, so der IFOAM-Manager.
Auch zukünftige Branchenherausforderungen wie Hydrokulturen auf Plastikplanen in den USA (gelabelt als Bio) und Reaktorfleisch aus dem Labor werden vom globalen Bio-Dachverband diskutiert. Mit Blick auf Hydroponik ist die Position der IFOAM eindeutig: Bodenlose Landwirtschaft ist nicht mit den Prinzipien von Bio vereinbar. Was In-Vitro-Produkte angeht, so ist noch keine offizielle Entscheidung gefallen. „Ein IFOAM-Mitglied müsste einen Antrag stellen, damit wir darüber verhandeln und eine Position entwickeln“, erklärt Cierpka. Das könnte zur nächsten Hauptversammlung geschehen, die Anfang Dezember in Taiwan stattfindet.
Lena Renner
1. Eine Innovationskultur schaffen: die Bio-Umstellung und Verbreitung von Best Practices fördern und dabei traditionelle und moderne Methoden kombinieren
2. Kontinuierliche Verbesserung anstreben, in allen Nachhaltigkeitsdimensionen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette
3. Transparenz und Integrität auf vielfältigen Wegen zulassen, über die Zertifizierung durch Dritte hinaus
4. Umfassende Aspekte und ergänzende Ansätze einer nachhaltigen Ernährung miteinbeziehen und durch Allianzen untermauern, sich aber gleichzeitig von Greenwashing abgrenzen
5. Akteure von der Landwirtschaft bis zum Endverbraucher sowie Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette stärken
6. Externe Kosten und gesellschaftliche Leistungen internalisieren, um das Engagement von Landwirten zu belohnen und Transparenz für Konsumenten und politische Entscheidungsträger zu schaffen