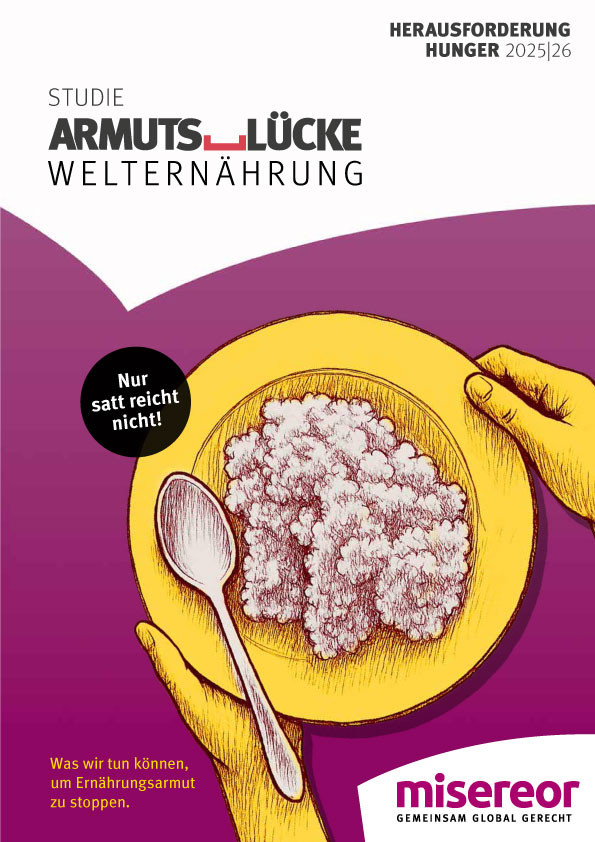Nachhaltigkeit
Welternährungstag: Hungerbekämpfung im Argen
Krisen, strukturelle Probleme und ‚verborgener Hunger‘
 © Pohl / Misereor
© Pohl / Misereor
Anlässlich des heutigen Welternährungstags haben zahlreiche Organisationen beleuchtet, wie es um den Kampf gegen Hunger weltweit bestellt ist. Ihr Ergebnis: besorgniserregend. Nach dem 18. Welthunger-Index, der letzte Woche vorgestellt wurde, sind über 735 Millionen Menschen weltweit unterernährt. Laut der Menschenrechtsorganisation FIAN verschärfen sich die strukturellen Ursachen von Hunger und Mangelernährung. Auf das Problem von ‚verborgenem Hunger‘, dem Mangel an Mikronährstoffen, haben der Arbeitskreis für Ernährungsforschung und Misereor hingewiesen.
Eine ‚sehr ernste Hungerlage‘ sieht der neue Welthunger-Index, der von den Organisationen Welthungerhilfe und Concern Worldwide herausgegeben wurde, etwa in der Zentralafrikanischen Republik und Madagaskar. Auch Burundi, Lesotho, Niger, Somalia, der Südsudan, Jemen und die Demokratische Republik Kongo fallen unter diese hohe Warnkategorie. Insgesamt sei die Lage in 43 Ländern ‚sehr ernst‘ oder ‚ernst‘. In 18 Ländern habe sich die Situation in den vergangenen Jahren verschlechtert und für 58 Länder sei das Ziel, den Hunger bis 2030 auf ein niedriges Level zu bringen, voraussichtlich nicht mehr erreichbar. Von den Auswirkungen seien vor allem junge Menschen betroffen, die laut den Autoren mehr in die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft einbezogen werden müssten. Leichte Verbesserungen verzeichnet der Index für Bangladesch, Dschibuti, Laos, Mosambik, Nepal, Timor-Leste und den Tschad.
„Die weltweite Hungerkrise bleibt ein drängendes Problem. Sie wird verschärft durch anhaltende Konflikte und Kriege, die Klimakrise und koloniale Kontinuitäten, die sich unter anderem in ungerechten Handelspraktiken niederschlagen“, so erklären die Grünen-Sprecherinnen Deborah Düring und Renate Künast zum Welternährungstag. Geopolitische Konflikte und die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten die globale Nahrungsmittelsicherheit seit dem Vorjahr weiter negativ beeinflusst. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen verzeichnet derzeit eine Finanzierungslücke von 60 Prozent – der niedrigste Stand seit Gründung des Programms im Jahr 1963. Weltweit würden staatliche humanitäre Hilfen gekürzt und angesichts internationaler Konflikte seien die Spendenbeträge zur Hungerbekämpfung zurückgegangen. Dadurch könnten 25 Millionen weitere Menschen an den Rand des Hungertods gebracht werden, befürchten Düring und Künast. Zur Abhilfe plädieren sie für die Unterstützung von Kleinbauern, agrarökologische Anbaumethoden sowie freien Zugang zu Saatgut. Es gelte, lokale Vermarktungsinfrastrukturen zu stärken, die Spekulation mit Nahrungsmitteln strenger zu regulieren und die Transparenz auf den globalen Agrarmärkten zu erhöhen.
In eine ähnliche Richtung geht die Problemanalyse der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Industrialisierung der Agrarsysteme, Landkonzentration sowie der wachsende Einfluss von Finanzinvestoren führten zur systematischen Ausgrenzung von kleinen und handwerklichen Lebensmittelproduzenten im globalen Süden. 2,5 Milliarden Menschen – rund 30 Prozent der Weltbevölkerung seien von mittlerer bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Seit der Jahrtausendwende seien schätzungsweise 100 bis 214 Millionen Hektar Land durch Landgrabbing an Investoren transferiert worden. Und die expandierende agrarindustrielle Landwirtschaft produziere nur wenige Nahrungsmittel. Seit 2000 sei die Anbaufläche von Palmöl, Zuckerrohr, Soja und Mais um 150 Millionen Hektar – eine Fläche etwa anderthalb mal so groß wie die Ackerfläche der EU – gewachsen. Im selben Zeitraum sei die Anbaufläche von Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Hirse und Roggen um 24 Millionen Hektar zurückgegangen. „Die globale Landwirtschaft ist immer weniger darauf ausgerichtet, die Menschen zu ernähren“, bedauert FIAN-Agrarreferent Roman Herre. Gleichzeitig würden die steigenden Hungerzahlen instrumentalisiert, um ökologischen Fortschritt auszuhebeln.
Dass es mit der Kalorienversorgung alleine nicht getan ist, macht der Arbeitskreis für Ernährungsforschung klar. Als ‚verborgenen Hunger‘ bezeichnet man einen Mangel an Mikronährstoffen, also an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder sekundären Pflanzenstoffen. Er trete vor allem in Entwicklungsländern auf, wo sich die ärmere Bevölkerung einseitig von stärkereichen Lebensmitteln wie Reis, Mais oder Maniok ernährt. Nach einer Studie, die das Hilfswerk Misereor Ende September vorgestellt hat, haben weltweit über drei Milliarden Menschen – mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung – keinen Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung, können sich also keine ausreichende Nährstoffzufuhr leisten.
Misereor und FIAN schauen jetzt hoffnungsvoll auf den 23. Oktober: Dann trifft sich der Welternährungsausschuss der Vereinten Nationen (CFS) in Rom, um Empfehlungen zur Reduzierung der Ungleichheit in der Ernährung zu erarbeiten und einen Mechanismus zu etablieren, der eine bessere Reaktion auf Krisen und Schocks wie Inflation und Corona gewährleisten soll.
Der Welternährungstag wurde 1979 eingeführt und soll an die Gründung der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO (Food and Agriculture Organization) am 16. Oktober 1945 erinnern. Mit dem zweiten Ziel für nachhaltige Entwicklung ‚kein Hunger‘ haben die Vereinten Nationen beschlossen, dass Hunger und alle Formen von Unterernährung weltweit bis 2030 beendet werden sollen.