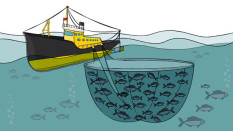Ernährung
Für Vielfalt, Geschmack und Regionalität
bioPress im Gespräch mit der Slow Food-Vorsitzenden Nina Wolff
 © Dirk Vogel
© Dirk Vogel
Wie können wir unsere Ernährungsumgebung verbessern? Was kann man gegen die Vereinheitlichung von Geschmack tun? Und wo sollte man seine Lebensmittel am besten einkaufen? Mit der Vorsitzenden von Slow Food Deutschland Nina Wolff unterhielt sich bioPress über Bausteine der Ernährungswende.
bioPress: Frau Wolff, Slow Food setzt sich für eine gesunde Ernährungsumgebung ein. Die hat wohl auch viel mit der Esskultur zu tun. Alle sprechen von der mediterranen Esskultur in Italien als Vorbild. Gibt es auch eine deutsche Esskultur?
Nina Wolff: Die Esskultur ist ja nichts Statisches, sondern immer im Wandel und mannigfaltigen Einflüssen ausgesetzt. Angesichts der stark wachsenden Bevölkerung, die auf die zehn Milliarden zugeht, müssen wir unsere Ernährungsweise anpassen und uns fragen, was eine gute Esskultur der Zukunft ist. Womit wir auch bei der Frage nach der Ernährungsumgebung wären. Eine solche sollte fair sein für heutige und künftige Generationen. Sie sollte so gestaltet sein, dass jeder die Chance hat, die eigene Ernährung anzupassen – sodass sie Tierwohl, Umwelt, sozialer Gerechtigkeit und Gesundheit zuträglich ist.
bioPress: Weltweit haben große Lebensmittelkonzerne die Ernährungsversorgung okkupiert. Ihnen scheint es weniger darum zu gehen, die Menschheit zu ernähren, als möglichst viel Profit aus ihrem Tun zu schlagen.
Wolff: Stimmt, die globale Ernährungsindustrie hat das Narrativ der Ernährungssicherung für sich entdeckt. Das kann uns aber ja nicht davon freisprechen, dass wir eine globale Verantwortung haben und unsere Ernährungsweise anpassen müssen. Dabei müssen wir ganz klar Produktion und Ernährungsweise gemeinsam in den Blick nehmen. Beides muss ökologischer und sukzessive pflanzlicher werden. Die mediterrane Ernährungsweise ist zum Beispiel traditionell überwiegend pflanzlich. Auch bei uns wurde früher nur wenig Fleisch gegessen. Bei aufgeklärten Köchinnen und Köchen gibt es Fleisch als Beilage zum Gemüse – und nicht umgekehrt.
bioPress: In Italien wird im Vergleich zu Deutschland ein Vielfaches an Gemüse produziert. Gemüse wächst bei uns einmal im Jahr und hat in Italien zwei bis drei Wachstumszyklen.
Wolff: Mit besseren Rahmenbedingungen durch Politik und Handel wäre auch bei uns noch Luft nach oben. Wir produzieren nur gut ein Drittel des Gemüses, das wir verzehren, selbst. Das liegt auch an einem hohen Konkurrenz- und Preisdruck. Wir können natürlich für pflanzliche Ernährung werben, aber letztlich muss die Politik die richtigen Anreize setzen und pflanzlichen Anbau fördern.
bioPress: Ein Slow-Food-Schwerpunkt ist der Geschmack. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der industriellen Landwirtschaft mit ihren ‚gedopten‘ Lebensmitteln und dem Verlust von Geschmack?
Wolff: Schon. Industrielle Landwirtschaft und Verarbeitung führen zur Vereinheitlichung von Geschmacksbildern und einer Entfremdung zu dem, was natürlich ist. Die Verbraucher*innen haben sich daran gewöhnt, teils wird erwartbare Einheitlichkeit so-gar als Qualität empfunden. Es wäre aber wichtig, der Vielfalt wieder mehr Raum zu geben. Eigentlich variiert jedes Lebensmittel etwas im Geschmack, und dafür bräuchte es wieder mehr Akzeptanz.
Die Agrarökologie, als Gegenentwurf zur industriellen Landwirtschaft, ist für Slow Food das maßgebliche Leitbild. Sie steht für eine ganzheitlich ökologische und gesunde Art, Landwirtschaft zu betreiben und Ernährungssysteme aufzubauen, erhält die biologische Vielfalt und die Böden. Das ist es auch, was sie für den Menschen gesund macht. Auch der gute Geschmack kommt daher, dass sich der Boden und eine Sorte ideal verbinden.
bioPress: Gibt es Zusammenarbeit zwischen Slow Food und der Landwirtschaft?
Wolff: In unseren Netzwerken sind natürlich auch Landwirtinnen und Landwirte vertreten und an der Formulierung unserer Positionen beteiligt. Sie sind zum Beispiel Teil der ‚Arche des Geschmacks‘ – ein Projekt, das bereits seit 1996 existiert. Darin sammeln wir Lebensmittel, Sorten, Rassen und Produktionsweisen, die zu verschwinden drohen, und versuchen, sie zu retten: indem wir sie als überlebenswichtig identifizieren, ein Netzwerk um sie herum aufbauen, Erzeugung und Marketing unterstützen. Die Produzentinnen und Produzenten können damit werben, dass sie ein Erzeugnis haben, das zur ‚Arche des Geschmacks‘ gehört, und Slow Food wirbt mit der Gesamtheit der Produkte.
Ein weiteres wichtiges Netzwerk ist unsere ‚Chef Alliance‘, das Bündnis der Köchinnen und Köche. Dabei pflegt jede und jeder für sich ein Netzwerk zu Erzeugung und Lebensmittelhandwerk, geht in den Dialog und fördert so in der jeweiligen Region eine kleinteilige Wertschöpfung.
bioPress: Wo sollte man nach Ansicht von Slow Food am besten einkaufen?
Wolff: Das kommt auf den Wohnort an. Ich würde mich umschauen, wo es in meiner Umgebung Produzentinnen, Handwerker oder kleine Händler gibt, die gute, umweltschonende und faire Lebensmittel anbieten. Das kann eine Solawi sein oder ein Hofladen, der Wochenmarkt, ein kleiner Fachhändler oder auch mal ein Bio-Supermarkt.
bioPress: Was wünschen Sie sich fürs Einkaufen? Was vermissen Sie? Was sollte sich ändern?
Wolff: Was ich mir wünsche, ist, dass Menschen wieder einen näheren Bezug bekommen zu Lebensmitteln, dass sie wirklich wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Dafür wäre es gut, wenn für die Versorgung mit Lebensmitteln wieder viel regionalere oder sogar lokale Lösungen in den Vordergrund treten. Das heißt, Märkte als Orte, in denen sich die Menschen alltagsfreundlich umfassend versorgen können, in denen aber das Angebot in Verbindung zur eigenen Region steht, möglichst sogar in einem solidarischen Zusammenhang mit den Landwirtinnen und Handwerkern der Region. Weniger Einheitlichkeit und dafür mehr Vielfalt und regionale Kompetenz wünsche ich mir.
In großen Städten gibt es ja relativ neue Formen von Regionalmärkten mit solidarischeren Strukturen, die zeigen, wie das Einkaufen der Zukunft aussehen kann: der FoodHub in München oder der SuperCoop in Berlin. Das sind Märkte, aus denen man mehr mit nach Hause nimmt als ein Lebensmittel: etwa Wissen um die Zubereitung und die Herkunft. Es wäre gut, wenn es mehr solche Märkte gäbe.
Wir brauchen Vielfalt in Natur und Kultur. Essen sollte wieder in den Mittelpunkt des Lebens rücken und seine Zubereitung nicht als Zeitverschwendung betrachtet werden, sondern als etwas, aus dem man Freude zieht.
bioPress: Wie schauen Sie auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung?
Wolff: Der Bereich der Gemeinschaftsverpflegung wurde inzwischen als einer der wichtigsten identifiziert – für Umsetzung und auch Kommunikation der Ernährungswende. Da ist einiges in Bewegung und es gibt viele, die was ändern wollen. Auch hier braucht es die richtigen Rahmenbedingungen und Unterstützung – zum Beispiel bei der Küchenausstattung und dabei, wieder richtig zu kochen.
bioPress: Sind Sie auch selbst im Schulungsbereich tätig?
Wolff: Ja, die Slow Food-Convivien – also die lokalen Gruppen, die vor Ort aktiv sind – machen selbst Geschmacksschulungen mit interessierten Menschen zu unterschiedlichsten Lebensmitteln: ob Gemüse, Fleisch oder Käse. Manche finden auch in der Öffentlichkeit statt, bei Veranstaltungen oder auf Marktplätzen.
Interview: Erich Margrander und Lena Renner