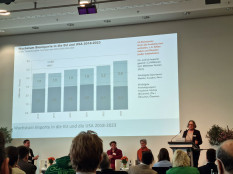Ökolandbau
Bio in Bayern: Nachfrage steigt, Umstellung hinkt hinterher
Landesvereinigung der Anbauverbände präsentiert neue Zahlen

Anlässlich der nahenden Biofach gab die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) heute aktuelle Zahlen zur Bio-Entwicklung in Deutschlands größtem Bundesland bekannt. Die Botschaft: Es geht wieder aufwärts mit dem Bio-Markt – allerdings hinkt die Umstellungsrate hinterher. Die LVÖ befürchtet daher in diesem Jahr eine Verknappung heimischer Bio-Rohstoffe und fordert faire Erzeugerpreise und politischen Rückenwind für eine bessere Umstellungsmotivation.
Die bayerischen Bio-Anbauverbände Bioland, Naturland, Biokreis und Demeter, in denen rund zwei Drittel der bayerischen Bio-Höfe organisiert sind, melden für das Jahr 2024 einen Flächenzuwachs von 1,3 Prozent. Das entspricht einem Plus von gut 4.600 Hektar. Gleichzeitig setzt sich der Strukturwandel weiter fort, da die Zahl der Verbandsbetriebe geringfügig zurückging, um 94 bzw. 1,2 Prozent. Durchschnittlich bewirtschaftet ein Betrieb rund 47 Hektar – was interessanterweise etwa neun Hektar über dem bayerischen Durchschnitt aller landwirtschaftlichen Betriebe liegt und damit laut LVÖ die Bedeutung des Ökolandbaus als „zukunftsorientierte Option für starke Betriebe“ unterstreiche.
Mit Blick auf den Bio-Flächenanteil rangiert Bayern aktuell bei knapp 14 Prozent – über dem Bundesdurchschnitt, aber noch weit entfernt vom Ziel von 30 Prozent Bio-Fläche im Jahr 2030. „Da ist noch eine ordentliche Lücke“, stellte Thomas Lang, 1. Vorsitzender der LVÖ Bayern, fest. Besonders bedenklich ist diese, da sich auf der Nachfrageseite wieder ein deutlicher Aufschwung abzeichnet, sodass die ausreichende Versorgung mit heimischen Bio-Rohstoffen auf der Kippe steht.
Dauerhaftes Bio-Markt-Wachstum in Sicht
Einen Einblick in den Bio-Absatzmarkt gab Andreas Hopf, Geschäftsführer der Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern mbH. Nach der bekannten Bio-Delle im Jahr 2022 erholte sich der Bio-Markt 2023 mit fünf Prozent Wachstum und konnte im Jahr 2024 mit geschätzt sieben bis acht Prozent Bio-Umsatz-Plus weiter zulegen. War die Steigerung 2023 laut Hopf noch größtenteils auf die Inflation zurückzuführen, habe im vergangenen Jahr auch wieder ein echtes Mengenwachstum stattgefunden – vor allem gegen Ende des Jahres.
Gleichzeitig setzte sich die Verschiebung im Bio-Absatz zum konventionellen Handel, insbesondere Discountern, und zu Bio-Eigenmarken weiter fort. Mit Daten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) präsentierte Hopf für das erste Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr eine positive Mengenentwicklung in puncto Bio-Frische um 7,5 Prozent für Discounter. Im selben Zeitraum konnten Vollsortimenter nur um 1,1 Prozent zulegen, während der Fachhandel sogar einen Rückgang um 12,6 Prozent hinnehmen musste.
Antonia Rees, Bioland-Expertin für den Bio-Milchmarkt, konnte für denselbigen ein Nachfrageplus über nahezu alle Produktgruppen hinweg bestätigen. Die Einkaufsmenge von Bio-Quark nahm 2024 etwa um zwölf Prozent zu; und der Bio-Käse-Absatz stieg in den letzten Jahren kontinuierlich und war noch nicht einmal von der Delle 2022 betroffen, berichtete die Fachfrau. Für den Bio-Milchmarkt konnte 2024 bereits eine Rohstoffknappheit beobachtet werden, dabei gingen nahezu alle Bio-Milchprodukte nach Deutschland. „Die Erzeugerpreise müssen steigen, damit es für Landwirte wieder attraktiv ist, Bio zu machen!“, folgerte Rees. Der von Bioland festgelegte Orientierungspreis – momentan 69,6 Cent pro Kilogramm Rohmilch – werde bislang am Markt noch lange nicht erreicht.
Umstellungsmotivation Einkommen
„Wir müssen jetzt auskömmliche Preise für Landwirte generieren – und dauerhafte Regalplätze garantieren“, forderte auch Wilhelm Heilmann, Geschäftsführer der Naturland Zeichen GmbH. „Händler fragen uns, was sie für mehr Bio-Umstellung tun können“, berichtete er. Der Orientierungspreis sei dabei ein wichtiges Thema, der durch Bio erzielte Mehrpreis für Erzeuger im Moment zu gering.
Die Naturland Zeichen GmbH verzeichnete von 2023 auf 2024 eine Zunahme von 28 Prozent für Naturland-zertifizierte Produkte im Handel. Zu einem Großteil sei dieses Wachstum auf neue Partnerschaften mit dem Discount und die Vermarktung unter Eigenmarken zurückzuführen. Beim Sicherstellen, dass die Erzeuger auch von den Partnerschaften profitieren, seien feste Preismodelle grundsätzlich schwer umsetzbar. Der Verband arbeite aber an Mehrjahresmodellen, über die teils auch die Einkäufer „ganz froh“ wären, sodass am Ende eine Win-Win-Situation erreicht werden könne.
Für dieses Jahr rechnet Andreas Hopf mit einem ähnlichen Flächenwachstum wie 2024, sodass die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot sich eher noch vergrößern werde. Es bestehe das Risiko, dass der Handel die Knappheit durch Importware deckt oder aber wieder mehr konventionelle Produkte in die Regale stellt. Auch wenn mehr Betriebe zur Umstellung bewogen werden könnten, würde sich das aufgrund der Umstellungsfristen nicht sofort im Markt bemerkbar machen. „Wir brauchen einen langen Atem“, folgerte der Experte. Vielleicht könne dann 2026 wieder ein deutlicher Flächenanstieg verzeichnet werden.
Vielfalt – nicht nur auf dem Acker
Am Ende der Pressekonferenz machte LVÖ-Chef Lang sich für eine offene, demokratische Gesellschaft stark und kritisierte das Einknicken einer Partei der Mitte vor den Rechtsextremen. Die Bio-Branche stehe für „Vielfalt nicht nur auf dem Acker, sondern auch in der Gesellschaft“, betonte er, und appellierte an die Parteien, sich nicht in einem monothematischen Wahlkampf zu verlieren.
In einem Positionspapier hat die LVÖ ihre Forderungen zur Bundestagswahl zusammengefasst, rund um den Kernaspekt ‚Planungssicherheit und Perspektiven für Erzeuger schaffen‘. Dazu gehört etwa der Bürokratieabbau für Bio-Betriebe, in einem konkreten Beispiel die Anerkennung des Ökolandbaus als ‚green by concept‘, um eine unnötige Doppelbelastung bei der Düngebedarfsermittlung zu eliminieren. Außerdem fordert die LVÖ mit Blick auf die Neue Gentechnik wirksame Koexistenzregelungen, eine durchgängige Kennzeichnung, wissenschaftsbasierte Risikoprüfung und Stärkung der öffentlich finanzierten Bio-Züchtungsforschung.
„Gemeinwohlleistungen müssen als Einkommensquelle etabliert werden“, schloss Lang. „Die Nachfrage ist da – jetzt müssen wir Betriebe für Bio gewinnen!“ Um Erzeuger zur Umstellung zu bewegen, brauche es nun Klarheit von politischer Stelle.
Lena Renner
Anlässlich des Themas Bio-Weidehaltung, die auch Betriebe in Deutschland laut einer kürzlichen Entscheidung der EU-Kommission künftig strikt umsetzen müssen, gab Thomas Lang ein Stück weit Entwarnung. „Wir sehen gute Wege, um mit den Betrieben gemeinsam eine gute Lösung zu finden“, sagte er. Mit Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus dem benachbarten Österreich gehe die LVÖ davon aus, dass am Ende etwa fünf bis sieben Prozent der 5.620 rinderhaltenden Bio-Betriebe in Bayern gezwungen seien, wieder konventionell zu vermarkten – und nicht etwa 20 Prozent, wie es teilweise kommuniziert werde. Die Verbände begleiteten die Höfe bestmöglich und stünden gleichzeitig in stetem Austausch mit dem Ministerium, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.