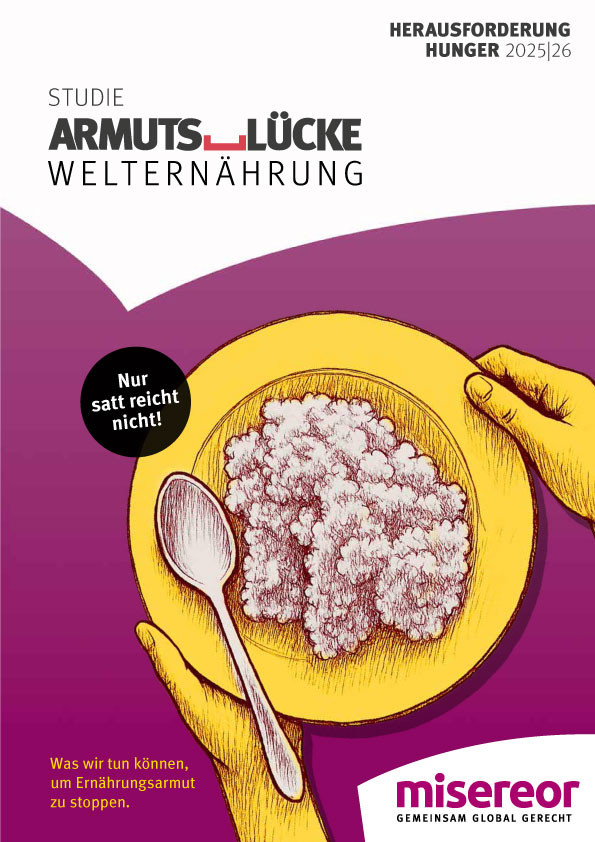Nachhaltigkeit
Chinas wachsende Lebensmittelnachfrage und ihre Umweltauswirkungen
IIASA-Studie zur nachhaltigen Ernährungssicherung
China ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde – die Befriedigung des chinesischen Nahrungsmittelbedarfs eine der größten Nachhaltigkeitsherausforderungen in den kommenden Jahrzehnten. Eine Studie von Forschern des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) und chinesischen Kollegen, die kürzlich in der Zeitschrift Nature Sustainability veröffentlicht wurde, hat die Umweltauswirkungen der wachsenden Nachfrage für China und seine Handelspartner bewertet.
Während die einheimische Produktion noch einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit des Landes leistet, spielen auch Importe eine zunehmende Rolle bei der Deckung des chinesischen Nahrungsmittelbedarfs – insbesondere im Hinblick auf die wachsende Nachfrage nach tierischen Erzeugnissen wie Fleisch und Milchprodukten.
„Die Bewertung der Auswirkungen der künftigen Nahrungsmittelnachfrage erfordert umfassende Analysen des Agrarsektors, während die Verfolgung der globalen Umweltauswirkungen Modelle erfordert, die den Handel mit anderen Regionen einzeln darstellen“, erklärt Hao Zhao, der Hauptautor der Studie.
Den Forschern zufolge wird der chinesische Nahrungsmittelbedarf voraussichtlich kontinuierlich steigen, vor allem im Bereich von Tierprodukten und den dazugehörigen Futterpflanzen. Die Ausweitung der Weideflächen und der damit verbundene Anstieg der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft stellen eine große Herausforderung für die nachhaltige Entwicklung der chinesischen Landwirtschaft dar.
Außerdem hat die zunehmende Abhängigkeit des Landes von Agrarimporten Auswirkungen auf die globale Umwelt. Die Studie ergab, dass bis 2050 doppelt so viel zusätzliche landwirtschaftliche Fläche in Form von Agrarprodukten aus dem Ausland nach China ‚importiert‘ werden wird, als im Inland angebaut werden kann. Für bestimmte Länder werden im Durchschnitt etwa 30 Prozent der Umweltprobleme mit den Exporten nach China zusammenhängen. So würden 2050 beispielsweise 48 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 33 Prozent der Treibhausgasemissionen des neuseeländischen Agrarsektors, 16 Prozent des Stickstoffverbrauchs in Kanada und elf Prozent des Bewässerungswassers in den Vereinigten Staaten nach China exportiert werden.
Die Verteilung der Umweltauswirkungen zwischen China und dem Rest der Welt würde wesentlich von der Entwicklung der Handelsoffenheit abhängen. In einem in der Studie entwickelten Szenario mit globalisiertem Handel würden beispielsweise mehr Milchimporte aus der EU und Rinderfleischimporte aus den USA zu geringeren Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario führen. Auf der anderen Seite würde dieses Szenario auch zu einem Anstieg der Rindfleischimporte aus lateinamerikanischen Ländern führen, in denen der Fußabdruck der Viehwirtschaft hoch ist.
Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass zur Deckung des chinesischen Nahrungsmittelbedarfs mehr Lebensmittel nachhaltig im Inland produziert werden sollten, besonders tierische Erzeugnisse. Dabei könne etwa die Produktivität der Wiederkäuer noch wesentlich verbessert werden. Gekoppelte Systeme für die Tier- und Pflanzenproduktion könnten zu einer nachhaltigeren Ressourcennutzung führen, unter anderem durch einen geringeren Stickstoffeintrag und weniger Schadstoffe. Auch eine Änderung der Verbraucherpräferenzen könnte viel bewirken.
„Um die globalen Auswirkungen der steigenden Nachfrage Chinas nach landwirtschaftlichen Produkten zu verringern, müssen politische Maßnahmen zur Förderung von nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion in China weiter verfolgt und weltweit gefördert werden, auch durch entsprechende Handelsabkommen", erklärt Co-Autor Petr Havlik. Die Forscher hoffen, dass ihre Arbeit zur Förderung der globalen Nachhaltigkeit beitragen kann.